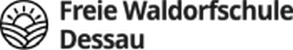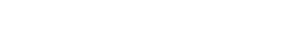Ganzheitlicher Ansatz
In der Waldorfpädagogik geht es darum, nicht nur das intellektuelle Denken zu fördern, sondern auch emotionale und praktische Fähigkeiten. Lernen soll nicht nur mit dem Kopf, sondern auch mit Herz und Hand erfolgen. Daher spielen neben den klassischen Schulfächern wie Mathematik oder Sprachen auch künstlerische und handwerkliche Tätigkeiten (z. B. Malen, Singen, Eurythmie, Werken) eine zentrale Rolle. Dies soll den Schülerinnen und Schülern eine ganzheitliche Entwicklung ermöglichen.
Lehrpläne an Entwicklungsphasen ausgerichtet
Der Lehrplan orientiert sich an den von Steiner beschriebenen Entwicklungsphasen des Kindes, die etwa sieben Jahre umfassen. Er ist so gestaltet, dass er die jeweilige körperliche, emotionale und geistige Reife der Kinder berücksichtigt. In den ersten Schuljahren stehen vor allem künstlerisches Tun, Fantasie und Sinneserfahrung im Mittelpunkt, während intellektuelles Lernen erst nach und nach mehr Gewicht erhält.
Individuelle Stärken fördern
Jedes Kind wird als einzigartig betrachtet. Der Unterricht ist darauf ausgelegt, die Persönlichkeit und Begabungen des Einzelnen zu unterstützen, ohne den Leistungsdruck durch Noten und Prüfungen zu verstärken.
Fokussierter Epochenunterricht
Ein besonderes Merkmal der Waldorfpädagogik ist der sogenannte Epochenunterricht. Hier werden bestimmte Fächer (z. B. Mathematik, Geschichte) über mehrere Wochen intensiv in den ersten Stunden des Tages behandelt. Dies ermöglicht ein tiefes Eintauchen in ein Thema, ohne dass es durch einen stundenplanmäßigen Wechsel unterbrochen wird.
Bewegungskunst Eurythmie
Eurythmie, eine besondere Form der Bewegungskunst, ist ein charakteristisches Merkmal der Waldorfpädagogik. Sie verbindet Sprache und Musik mit körperlicher Bewegung und soll die Verbindung von Körper, Geist und Seele fördern, das ästhetische Empfinden stärken sowie die innere Balance der Kinder fördern.